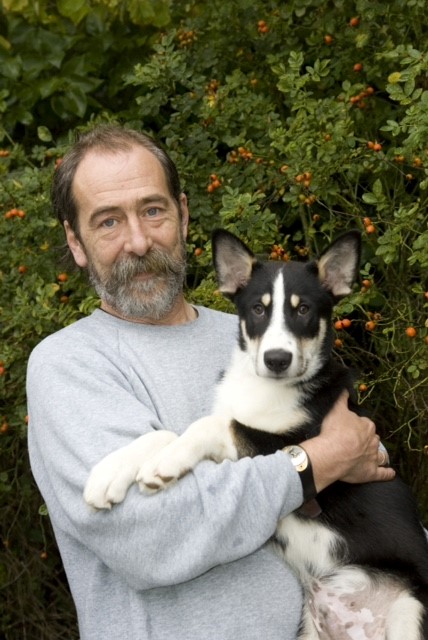Lieber Ulv,
Du hast ein Buch geschrieben: Dog Management.
1. Ist das Buch für Chefs oder/und für Hundebesitzer?
Sowohl als auch. Die Haupt-Herausforderung beim Schreiben dieses Buches war die Brücke zwischen diesen beiden vermeintlich unvergleichbaren Gruppen zu schlagen. Erst in dieser neuen Verbindung wurden Missstände sichtbar, die zuvor nie benannt werden konnten.
2. Was ist die Kernaussage des Buches?
Die Gleichwertigkeitserkenntnis. Erst, wenn du dich selber kennst und bereit bist, das eigene Bedürfnis auch bei deinem Gegenüber vorauszusetzen, bist du in der Lage, zu führen. (Ich sehe dich und erkenne mich)
3. Was bedeutet gute Führung eines Hundes für Dich?
Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen der Führung von Menschen und der von Hunden). In Aus der Erkenntnis, dass alle Säugetiere ein enormes Sicherheitsbedürfnis vereint, erklärt sich automatisch auch die gemeinsame Definition guter Führung. Gute Führung handelt immer zum Wohle der Gemeinschaft. Ihre Hauptaufgabe besteht vorrangig darin, die sich Anvertrauten vor den Gefahren des Alltages zu schützen.
4. Wie bewertest Du die „Vermenschlichung“ von Hunden?
Zuerst müsste man einmal klären, was denn mit „Vermenschlichung“ eigentlich gemeint ist. Ich bin immer wieder irritiert, wenn bestimmte Personengruppen dogmatisch die „Vermenschlichung“ des Hundes anprangern und sich gleichzeitig der Hundepsychologie zu bedienen, um ihre zum Teil sehr merkwürdigen Betrachtungsansätze als hundgerecht zu rechtfertigen. Überraschenderweise fällt dabei jedoch auf, dass die sogenannte Hundepsychologie eine „Eins zu Eins“-Adaption der Humanpsychologie ist. Ohne Abweichung. Schon verwirrend, nicht wahr?
Ich sehe den Hund von jeher gleichwertig. Ich schätze seine Besonderheiten und seine hohe Kompatibilität zu uns Menschen. Unsere Aufgabe besteht darin, ihm jede Chance zu ermöglichen, gut und artgerecht in unserer Gemeinschaft leben zu können.
Das kann allerdings nur gelingen, wenn wir nicht versuchen, selbst zum Hund zu werden, sondern ihm die eigene Anpassung an unsere vorhandenen Strukturen ermöglichen.
Wenn also „Vermenschlichung“ bedeutet, dem Hund gegenüber menschlich zu bleiben, dann stimme ich dieser mit voller Inbrunst zu.
5. Was lehrst Du Deine Kunden?
In erster Linie, kritisch zu sein und nicht aufzuhören, zu hinterfragen.

Foto: Ulv Philliper
6. Worin unterscheidet sich Dein Ansatz von den herkömmlichen Philosophien in der Hundeszene?
Am auffälligsten dort, wo man es am wenigsten vermutet. In der Alltagstauglichkeit. Um einen Hund angemessen auf die Begleitung unseres Alltages vorzubereiten, müsste man selbstverständlich den Alltag mit seinen besonderen Herausforderungen als Vorlage für seine Vorbereitung heranziehen.
Alltag ist spontan. Das bedeutet, dass wir zu keinem Zeitpunkt sicher sagen können, wann wir von einem Ereignis überrascht werden. Gleichzeitig können wir weder das Ereignis selbst, noch dessen Intensität im Vorfeld benennen. Zusammengefasst heißt das, uns und unseren Begleiter erwartet nicht nur der unbekannte Zeitpunkt sondern auch die unbekannte Situation.
Des Weiteren ist festzustellen, dass die Anzahl der unbekannten Situationen unendlich ist.
Diese für Jeden zugänglichen Fakten lassen folgerichtig nur einen Rückschluss zu: Um in einem solchen Alltag zu bestehen, muss ein Hund lernen, bei einem Signal ohne Verzögerung reagieren zu können und, so schnell es ihm möglich ist, zu handeln. Man könnte auch verkürzt „Signal ist gleich Handlung“ sagen. Alltagstauglich muss immer auch „Worst Case“-tauglich sein.
Mir ist bis zum heutigen Tag noch keine Schulungsform oder Philosophie begegnet, die diese unumstößlichen Notwendigkeiten auch nur im Ansatz berücksichtigt.
Eben diese Erkenntnisse haben mich schon vor vielen Jahren dazu veranlasst, mein eigenes, damals noch konventionelles Training, in Frage zu stellen. Mir war zu diesem Zeitpunkt nicht im Geringsten bewusst, welches Ausmaß an Missständen und Fehlinterpretationen sich dadurch aufdecken würden, dass die Bereitschaft, das Vorhandene zu hinterfragen, fehlt.
Die grundsätzliche Annahme, dass Mensch und Tier „anders“ wären und somit nicht vergleichbar, stellt hierbei die Ursache aller späteren bis zum heutigen Tage anhaltenden Fehleinschätzungen des Hundes dar. Dass aber gerade das Argument „Tier“ gar nicht ein Kriterium der Unterscheidung, sondern eher der Gleichheit darstellt, hat mich dazu bewogen, ausschließlich mit Hilfe sogenannter „Ist-Zustände“ (unstrittige Fakten) das Thema Hunde neu zu beleuchten.
7. Vor allem Besitzer von jagenden Hunden fühlen sich von Deiner Herangehensweise und Deinen Zielen angesprochen. Warum ist das Deiner Meinung nach so?
Das überrascht mich nicht wirklich. Im Verlauf der letzten 26 Jahre konnte ich deutlich beobachten, wie durch die Einführung der sogenannten positiv verstärkenden Hundeausbildung zeitgleich ein mehr als nur auffälliger Anstieg sogenannter jagender Hunde zu verzeichnen war.
Die zu dem damaligen Zeitpunkt längst überfällige Abwendung von der sogenannten negativen Hundeerziehung scheiterte an dem kläglichen Versuch, sich ausschließlich nur methodisch von dieser abgrenzen zu wollen. Das Gehorsamsdenken wurde ungeprüft von den Verfechtern des positiven Gedankens weiterhin beibehalten.
Damit nahm das Unglück seinen Lauf. Gehorsam und positive Verstärkung sind zwei Komponenten, die in Kombination die absolute Ohnmacht des Hundehalters garantieren.
Folgerichtig kann man feststellen, dass das vermeintliche Jagdverhalten, das wir heute allerorts beobachten können und fälschlicherweise als Jagdinstinkt verurteilt wird, nichts anderes ist, als das Produkt dieser absurden Zwangsehe.
Ich glaube, dass ich gerade durch unsere Videos deutlich machen konnte, dass dieses, nachweislich auf einer falschen Wahrnehmung beruhende Problem, jederzeit wieder gemeinsam rückgängig zu machen ist.

Foto: Ulv Philipper
8. Wie siehst Du den Hund? Was macht ihn für Dich aus?
Ich sehe in dem Hund meine fehlende Hälfte, um vollständig zu sein. Wie schon häufig zitiert, aber dadurch nicht weniger wahr: „Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber es ist nicht lebenswert!“
9. Wird der Hund Deiner Meinung nach in der Gesellschaft wertgeschätzt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass der Hund geliebt wird, dass es ihm aber an wahrer Wertschätzung mangelt.
10. Wo sind sich Mensch und Hund Deiner Meinung nach ähnlich? Wo unterscheiden sie sich?
Der wohl auffälligste Unterschied besteht in der Optik des Hundes. Er sieht natürlich besser aus!
Ansonsten erkenne ich zwei hochtalentierte Säugetiere mit individuellen besonderen Fähigkeiten und verbindenden gemeinsamen Antriebsmotiven, die sich fast magisch anziehen.
11. Siehst Du ein grundlegendes Missverständnis im Umgang des Menschen mit dem Hund?
Das wohl größte Missverständnis besteht noch immer darin, dass im Umgang mit dem Hund kein Vergleich zu sich selbst zugelassen wird. Die größten Ohnmachten des Menschen wie Jagd-, Angst- und Aggressionsverhalten würden sich in Luft auflösen, wenn wir beginnen würden, Bereitschaft zu fördern statt Gehorsam zu drillen.

Foto: Ulv Philipper
12. Welche Entwicklung siehst Du im Hinblick auf die Mensch-Hund-Beziehung?
Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich die Mensch-Hund-Beziehung in Zukunft weiterhin zum Positiven verändern wird. Ich kann bei meinen Kunden eine deutliche Bereitschaft erkennen, propagierte unumstößliche Wahrheiten nicht mehr ohne weiteres zu akzeptieren. Das eröffnet Raum für neue Fragen und Antworten.
13. Was können wir vom Hund lernen?
Sich auf das Wesentliche des Lebens zu konzentrieren. Das heißt, Zeit miteinander zu genießen und sich nicht von den banalen Äußerlichkeiten ablenken zu lassen.
14. Was kann ich tun, um meinen Hund besser zu verstehen und ihn zu führen?
Bei der Empfindung der Bedürfnisgleichheit ist die Antwort ganz einfach. Stell dir einfach vor, du wärst in seiner Situation und stell dir die Frage, was du von deinem Gegenüber erwarten würdest.
Lieber Ulv, vielen Dank für Deine Zeit!
Nina Morgenstern